Die gemäßigte Utopie des Radfahrens ist die Überzeugung, man könne sich und seine wilden Gedanken für den Augenblick von ein paar leicht angestrengten Kilometern verlassen, sich also selbst enteilen, ohne sich verlieren zu müssen. Um schließlich als geläuterter Mensch zurückzukehren. Das ist beim Spaziergang anders, der als gelungen gilt, wenn der Aufbrechende sich auf dem Weg treffsicher begegnet. Und erst recht ist es verschieden zum Autoreisen oder Fliegen. Da hat der Geist zuweilen Mühe, überhaupt hinterherzukommen.
Kategorie: Allgemein
Rumpf-Team
Zweigeteilte Bundesliga: Der Profi-Fußball leidet unter der Dominanz weniger großer Vereine. Mancher Traditionsklub muss deutlich sparen, um die Lizenz für den Spielbetrieb nicht zu verlieren.

Der neue Mannschaftsbus des FC St. Pauli
Nachhomerisches Gelächter
Nicht nur Tragödien haben eine Fallhöhe. Auch Komödien. Sie reicht von der überrumpelnden Belustigung bis zur banalen Lächerlichkeit.
Wie im richtigen Leben
Das unterhaltsamere Theater findet oft hinter der Bühne des Schauspiels statt. Als zum ersten Probetag einer Broadway-Inszenierung deren Komponist mit einer blauen Kornblume im Knopfloch erschien und Champagner in der Hand, die Akteure herzend, flüsterte Truman Capote einem Freund* ins Ohr: „Heute ist’s Liebe. Morgen sind’s die Anwälte.“ Der lebenskluge Schriftsteller und Autor des Stücks sollte recht behalten.
*Der Freund war der britische Theaterregisseur Peter Brook, der diese Geschichte lustvoll erzählt: Der leere Raum, 24.
Wir Platoniker
Es sind noch letzte Reste des Platonismus, die uns überzeugt sein lassen, in der Verführung stecke mehr Verirrung und Abschweifung als Führung. Dabei würde sich keiner überhaupt auf den Weg gemacht haben, hätte er nicht den Eindruck, etwas Verlockendem zu folgen. Kein Leben kommt ohne den kleinen Betrug aus.
Zeitgenossen

Einstein: „Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.“ Aber: „Wenn man zwei Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität.“
Queen Elizabeth II., die während ihrer Regentschaft bisher sechs Päpste überlebt hat: „The true measure of all our actions is how long the good in them lasts.“
Papst Franziskus zitiert seinen Vorgänger: „Diktatur des Relativismus.“
Fast Kunst
Klappern gehöre zum Handwerk, sagt der Volksmund. So machten die fahrenden Genossen im Mittelalter auf sich aufmerksam, mit einem Holzgerät, um ihre Produkte besser zu verkaufen. Das erzeugte ein diskretes Geräusch, wenn man es schwang, und wurde auch am liturgielosen Karsamstag eingesetzt statt der volltönenden Kirchenglocken. Wir klappern heute nicht mehr. Dafür plappern wir umso intensiver. Und meinen, auf diese Art dasselbe Ziel zu erreichen: die Aufmerksamkeit unserer Nebenmenschen für Augenblicke zu zwingen. Doch allzu oft gilt das Gegenteil. Plappern zerstört das Handwerk, weil im ungehemmten Redeschwall vieles erdrückt wird, das die Sache erst interessant macht: Neugier, das Geheimnis eines Entstehungsprozesses, die Kunstfertigkeit, der Ernst, nicht zuletzt die angemessene Distanz gegenüber dem eigenen Werk.
Drei schöne Gerüche
Frischer Kaffee, frische Brötchen, frischer Buchleim. – Die Tagesrationen sind da.
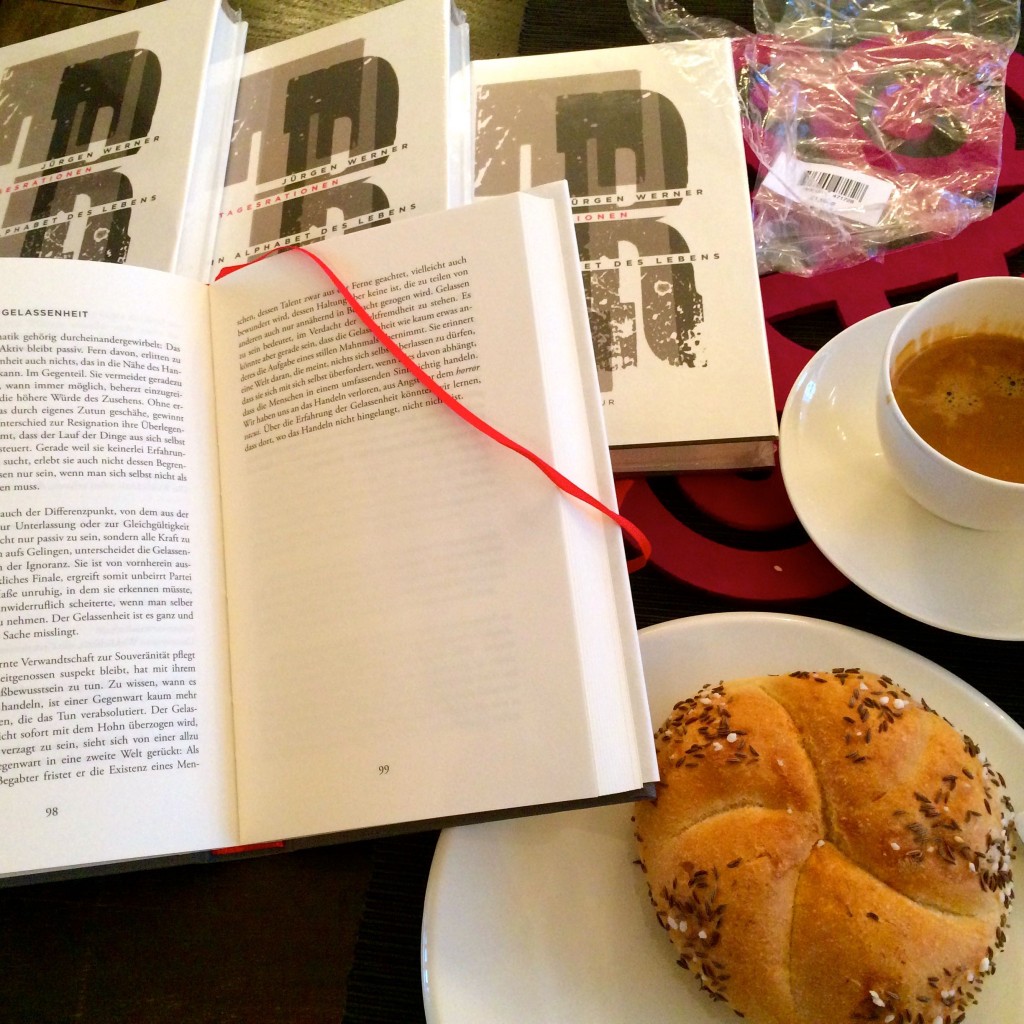
10. Sonntagskolumne: Grenze
Aus gegebenem Anlass: zum Mauerfall am 9. November 1989
… Die Grenze ist ein tragisches Symbol. An ihr zeigt sich, dass wir uns vergeblich mühen, ohne Verletzungen durchs Leben zu finden. Wir müssen sie überschreiten – die Grenzen der Höflichkeit, der Fairness, des Wissens, der Nähe wie der Distanz, des Vertrauens oder der Belastbarkeit –, sie alle stehen der eigenen Entwicklung im Weg. Im Gefühl, die eigenen Möglichkeiten nicht ausgereizt zu haben, schlummert Unzufriedenheit, genauso wie in der Gewissheit, sie überstrapaziert zu haben, ein Scheitern offenkundig wird. Zwischen beiden wählen zu können, ist eine Alternative, die zu entscheiden sich auf keine Tendenz zu berufen vermag. Nirgendwo wird die menschliche Endlichkeit sinnfälliger als dort, wo die Sehnsucht, sich zu entfalten, auch als Hang zur Übersteigerung entdeckt wird …
Aus den Tagesrationen. Ein Alphabet des Lebens. Das Buch erscheint morgen.
Zu wenig Zeit für zu viel Welt
Man lernt viel über den Menschen, wenn man nur seine beiden Fragen nach der Zeit ernst nimmt. Die übliche Weise „Wie spät ist es?“ erlaubt die Gegenvorstellung, warum er nicht mit gleicher Berechtigung regelmäßig wissen will, wie früh es sei. Und so die Antwort geradezu provoziert, es sei eh zu spät. An der zweiten, ungewöhnlicheren Erkundigung, was die Stunde geschlagen habe, wird das ganze Ausmaß seines verqueren Verhältnisses zum Lauf der Dinge deutlich. Was will auch einer wissen, der so fragt, wenn seine Haltung verrät, dass es offensichtlich umgekehrt ist: Die Stunde hat ihn geschlagen.
Die Wahrheit über unsere großen Gefühle
Das Glück ist nichts als die Tünche auf der Fassade des Lebens. Auch wenn es anfangs frisch strahlt: Wer allzu oft im Regen stehen gelassen wird, behält nur noch die ausgewaschene, blasse Erinnerung an schönere Tage.

Wandmalerei in Rödelheim
Leibhaftig
Der Wilde, der dem weißen Mann auf dessen Frage, warum er nackt herumlaufe, antwortet: „Bei mir ist alles Gesicht“*, entlarvt nicht so sehr das Schamgefühl als den Kleinmut des Verwunderten. Was wir mit Recht unser Geheimnis nennen, lässt sich nicht rauben, wenn man uns nimmt, was wir sonst haben; worin wir uns verraten, lässt sich nicht verbergen, indem wir uns verstecken hinter Gepflogenheiten, Ritualen, Kulturformen oder Usancen. Der menschliche Körper ist nie nur Körper – die Alten hätten über ihn gesagt, er sei Leib. Und somit ein Symbol.
*Diese Kurzgeschichte erzählt Jean Baudrillard in seiner Abhandlung „Von der Verführung“, 42f.
Guten Morgen
Die Morgenfrage, wie man geschlafen habe, lädt ein zur ersten Schummelei des Tags. Nur nicht sagen, man habe geruht wie ein Stein. Es könnte mancher schlechten Laune, die sich im Lauf des Bürogeschäfts einstellt, die plausible Begründung nehmen und damit die Chance, sie guten Gewissens ausleben zu können.
Rechenkünstler
„Du musst mit allem rechnen.“ – Schon in der Mathematik hat ihn überfordert, wenn er über die Arithmetik hinaus in die Analytische Geometrie oder gar Stochastik wechseln sollte. Da stand er an der Tafel jedes Mal wie ein begossener Pudel mit leerem Kopf. Kein Satz hätte ihn in seiner Lebenssituation peinigender treffen können als diese einfache Aufforderung: Wie geht das, mit allem zu rechnen? Das Wort bedeutet für ihn nicht nur höchste Ungewissheit; es berührt vor allem seine größte Unfähigkeit.
Fachkraft
Umzugsservice in Zeiten des Managements by Delegation: Drei beraten, wie die Kisten raumsparend zu stapeln sind; einer schleppt sie.
9. Sonntagskolumne: Bildung
… Bildung ist die Fähigkeit, sich auch auf den Umwegen des Lebens auf sich selbst verlassen zu können …
Aus den Tagesrationen. Ein Alphabet des Lebens. Das Buch erscheint am 10. November.
Im Aufwind

Branche im Überflug: Ein paar wenige Urteile gegen den Fahrdienst Uber haben genügt, die Taxifahrer vor Freude abheben zu lassen. Konkurrenz belebt das Geschäft, deren Verbot belebt die Preise. Der Monopolist jubelt, nicht nur am Frankfurter Flughafen
Reife Frucht
Jene Menschen, denen wir auf Anhieb das Merkmal zuschreiben, sie seien eine Persönlichkeit, hatten vielleicht nur das Glück, langsam werden zu können, was sie sind, wohingegen alle anderen schnell werden mussten, was sie nicht sind.
Rezensionsrezension
Der „heilige Trinker“ Joseph Roth war kein ausdauernder Leser, dafür aber ein höchst eifriger Rezensent. Warum ein Buch genau studieren, wenn sich über das Werk eine unterhaltsame Geschichte erzählen lässt, an die nur ein scharfes Urteil gehängt werden muss? Seinem Mitgenossen im Exil, dem Schriftsteller und Verleger Hermann Kesten – wie so viele Juden waren sie vor den Nationalsozialisten geflohen –, legte er einst eine Kritik zu dessen jüngster Publikation vor, damit dieser sie vor der Veröffentlichung begutachtete. In der hieß es ursprünglich am Schluss: „Ich verstehe den Roman nicht. Vielleicht ist Kesten ein großer Humorist.“ Der angesprochene Autor strich den vorletzten Satz und das Wort „vielleicht“. So erschien der Text dann auch. Und Kesten hatte sich als genau der erwiesen, als der er durch seine Streichungen von allen definitiv wahrgenommen werden wollte: als Mann, der mit großem Ernst nicht alles im Letzten ernst nimmt.
Real und ideal
Umgekehrt zur realen Anschauung, bei der ein Horizont gebildet wird über den eingenommenen Standpunkt, stellt sich eine geistige Perspektive erst ein, wenn es den Horizont schon gibt, auf den sie sich bezieht.
Vom rechten Maß
Es muss ein verwirrtes Gemüt gewesen sein, das die Formel „Zu viel des Guten“ erfunden hat. Was zu viel ist, kann nicht gut sein.
Vegetarier, demaskiert

Fleischwolf im Schafspelz
8. Sonntagskolumne: Erfolg
… Erfolg zu haben meint, dass es so gekommen ist, wie man dachte, obwohl es jederzeit hätte anders kommen können. Wie gefährdet er immer wieder ist, drückt sich aus in der plötzlichen Erleichterung, wenn er sich eingestellt hat, und dem Wunsch, ihn zu feiern. Es sind die kleinen Triumphe, die Zufallsneigung der Zukunft überlistet zu haben, die einem Erfolg den großen Gestus des Herrschaftsakts geben. Und die mit jedem nächsten die Vorstellung befremdlich stark wachsen lassen, er sei planbar. Das ist ein partieller Fehlschluss. Auch wenn wir zunehmend besser verstehen, was zum Erfolg führt, ändert das nichts daran, dass es nicht allein in unserer Hand liegt, ihn zu erreichen. Eigentlich erstaunlich, dass man bei erfolgreichen Menschen nur selten in gleichem Maß Dankbarkeit erkennt …
Aus den Tagesrationen. Ein Alphabet des Lebens. Das Buch erscheint am 10. November.
Stumpfer Sinn, kein Stumpfsinn
Im Vereinslied des FC Schalke 04 findet sich in der dritten Strophe der Vers: „Mohammed war ein Prophet, der vom Fußballspielen nichts versteht.“ Als im Jahr 2009 eine Reihe von islamischen Theologen die religiöse Unbedenklichkeit des Liedguts auftragsgemäß erklärten, atmete man im Verein auf. Die offiziell attestierte Blasphemiefreiheit des Reims sorgte im einzigen Stadion mit einer Kapelle in den Katakomben für eine neue Unbeschwertheit bei der Anrufung des konfessionsfreien Fußballgottes. Seither schmettern die Fans wieder lautstark in die Runde, dass der Religionsstifter trotz seines Defizits im deutschen Nationalsport „aus all der schönen Farbenpracht … sich das Blau und Weiße ausgedacht“ habe. Man kann es auslegen als ein Zeichen von besonderer Ignoranz oder, freundlicher, als Ausdruck höherer Weisheit. Was zeigt, wozu die Wissenschaft vom frommen Wesen und Unwesen eigentlich taugt: zur Entschärfung von Exzessen.