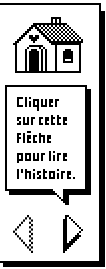„Geschichte ist die Summe der Lügen der Sieger.“ So bestimmt es Tony Webster, der Protagonist in dem Roman „Vom Ende einer Geschichte“. Julian Barnes, der Autor jener Novelle über die Zerstörung von Identität durch Wahrheit, zögert nicht, der Definition des Schülers einen Ergänzungssatz beizulegen. Geschichte sei allerdings auch immer die Selbsttäuschung der Besiegten, lässt er den Lehrer erwidern. Die Verfälschungstendenz, mit der wir unsere Vergangenheit verklären, reicht so weit, dass selbst die Siege und Niederlagen bei genauerem Hinsehen niemals nur Erfolge gewesen sind oder ein nüchternes Scheitern darstellen. Noch in der Stunde, da sich Entscheidendes ereignet, beginnen wir mit der Mythenbildung. (Es wäre interessant, mit scharfem historisch-kritischen Blick herauszubekommen, ob der ausgewechselte Stürmer Klose seinem Ersatz Götze wirklich zugerufen hat, dass dieser den erlösenden Treffer im Finale erzielen werde. Und ob Joachim Löw seinem „Wunderkind“ tatsächlich in der Halbzeit der Verlängerung, als er ihn ins Kinn zwickte, den Stürmer aufgeforderte hatte, der Welt zu zeigen, er sei besser als Messi. Was dieser dann ja auch in einem glücklichen Augenblick gehorsam tat.) Es sind die Erzählungen, weniger die Ereignisse, die unser Selbstverständnis prägen. Wer wir sind, hängt nicht so sehr an der Frage, ob etwas wirklich ist, als an der Akzeptanz dessen, was hätte wirklich sein können. „Nicht möglich“, rufen wir manchmal voller Erstaunen aus. Als Urteil über eine Geschichte gesprochen, ist es die Vernichtung dessen, der darin sein Selbstbild artikulieren wollte.