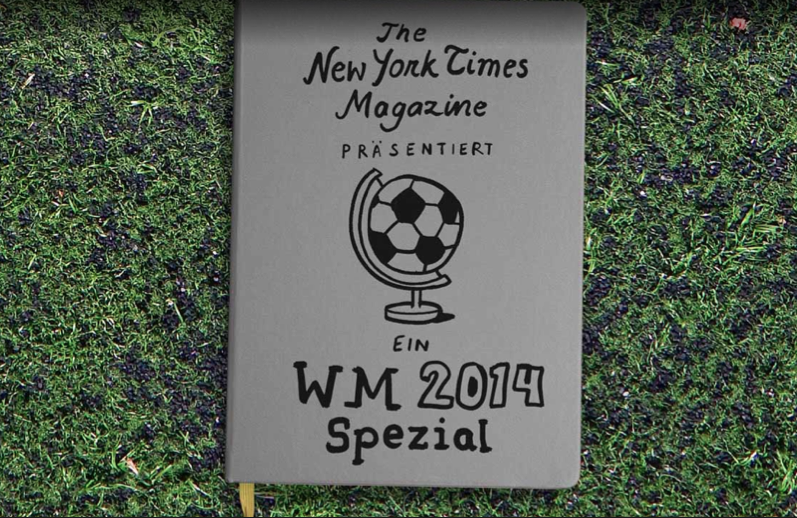In der Wahrnehmung des Fußballs unterscheiden sich Akteur und Fan an einem wesentlichen Punkt. Der Spieler darf kein Gedächtnis haben, wohingegen der Anhänger genau davon lebt. Der Sieg von gestern hat für die Mannschaft keine Bedeutung, wenn es heute darum geht, eine Niederlage zu vermeiden. Viel kommt darauf an, aus einem Misserfolg keine grundsätzlichen Zweifel zu ziehen, um in die nächste Begegnung mutig und voller Zuversicht zu gehen. Auf einem Titel lässt sich nicht ausruhen, wenn in der nächsten Saison alles von vorn beginnt. Wohingegen der enthusiastische Sympathisant alles aus der Vergangenheit aufsaugt, um daraus abzuleiten, dass es diesmal gut ausgeht. Dabei muss er gar nicht in den Archiven stöbern. Am zuverlässigsten gibt ihm der Schmerz Auskunft, der noch jahrelang nach einer demütigenden Pleite tief im Gemüt verankert ist.
Kategorie: Allgemein
Beißhemmung
Die Ursprungsgeschichten des Fußballs lesen sich wie das „Who is Who“ der englischen Bildungsanstalten: Eton, Winchester, Harrow, Rugby, Shrewsbury, alles bekannte Public Schools, später dann das Trinity College in Cambridge, in dem so berühmte Zöglinge wie Francis Bacon, Isaac Newton oder Ludwig Wittgenstein einst studierten. Um der wilden Treterei nach dem Ball und dem Bein des Gegners ein Ende zu bereiten, wurden in diesen Lehrinstituten strenge Regeln für den Sport erlassen, deren wesentliche pädagogische Absicht war, die Schüler zu Disziplin zu erziehen und ein Bild von rangfreier Gleichberechtigung, vor allem zwischen den Altersklassen, zu vermitteln. Der Teamgeist war geboren. Nach acht Stunden nur rauften sich jene Studenten zusammen, die sich auf einheitliche Regeln für alle Fußballspieler verständigten. Selbst das schien ihnen viel zu lang zu sein für die neuen Laws of the University Football Club. Das war Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Und es mutet an angesichts beißwütiger Stürmer heute, einseitig nachlässiger Schiedsrichter, endloser Debatten um die Torlinientechnik oder den Freistoßspray, die Korruption der Funktionäre und die politische Ignoranz der Verbände, als hätten diese honorigen Fußball-Pioniere damals ein ganz und gar anderes Spiel im Sinn gehabt.
Vier Freunde
Berti Vogts entdeckt Oliver Bierhoff 1996 und setzt ihn gegen alle Widerstände als Mittelstürmer ein. Der schießt das Golden Goal im Finale; das deutsche Team holt unter Kapitän Jürgen Klinsmann letztmals einen großen Titel und wird Europameister. Acht Jahre später ist es wieder Vogts, der Klinsmann dem Fußballbund als Nationaltrainer empfiehlt. Dieser nimmt sich Jogi Löw und Bierhoff an seine Seite; gemeinsam entwickeln sie die Bedingungen für das Sommermärchen 2006. Nun treffen alle vier im letzten Vorrundenspiel in Brasilien aufeinander, zwei hier, zwei beim Gegner USA. Allenthalben versichern sie, nichts abzusprechen, im vorhinein keinen Kontakt zueinander zu suchen. – Wenn Freunde sich blind verstehen, können sie sich auch stumm verständigen.
Neuland
„Mann, bist du naiv.“ Der schlechte Ruf, den die Unbedarftheit im allgemeinen besitzt, unterschlägt, wieviel Charakter zu einem Menschen gehört, der trotz aller Erfahrungen nicht zynisch geworden ist und fähig, eine Sache so leidenschaftlich und ernsthaft zu beginnen, als begegnete er ihr zum ersten Mal.
Der Fluch
Geschichte des großartigen Christoph Niemann über den angeblich bösen Geist, der in Brasilien spukt seit dem verlorenen Heim-Finale bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 1950 (Das Stück verneigt sich diskret vor dem Stuttgarter Lehrer des Autors Heinz Edelmann, der vorgestern 80 Jahre alt geworden wäre. – New York Times Magazine in Kooperation mit dem Zeit-Magazin).
Zum Abspielen auf das Bild klicken und dann den Pfeilen folgen.
Klingende Münze
Der Goldhändler balanciert den Krügerrand auf dem Daumengelenk und pustet fest. Zur Faszination seines kleinen Publikums schwingt sich die Münze ein in einen hohen Ton, fast wie ein helles Tinnitusgeräusch. So etwas ginge nur mit dem Edelmetall, erklärt er, weshalb es auch über Jahrtausende wertbeständig ist. Die Echtheit des Stücks lässt sich auf diese Weise leicht prüfen. Der erstaunte Zuschauer lernt vor allem, was ein Original ist: keine Eigenschaft der Sache selbst, aber der Name für die Verlegenheit, sie beim besten Willen nicht kopieren zu können.
Was sich vom Fußball lernen lässt
Es kommt selten vor, dass große Geschichten groß zu Ende gehen. Dabei schenkt das Scheitern gleich zwei Gelegenheiten, sich formvollendet aus der Affäre zu ziehen: in der Tragik einer unverdienten Niederlage und im Respekt des Geschlagenen vor dem Sieger wie der eigenen Schwäche.
Formkrise
Ende einer Liebesbeziehung: die Höflichkeit zieht ein, der Respekt zieht aus.
Die Aufgabe
„Das ganze Programm einer hemmungslosen Unterwerfung der Lebenswelt unter Imperative des Marktes muss auf den Prüfstand.“ – Jürgen Habermas, Nach dem Bankrott, in: Die Zeit, 6. November 2008
Zum 85. Geburtstag des Philosophen

Wo bleibt der Aufstand, wo ist der Prüfstand: Protestfolklore vor der Europäischen Zentralbank
Generationenübergreifend
So flüchtig wie der Blick sind zuweilen die Komplimente. Sie werden im Vorübergehen großzügig verschenkt und schmeicheln im Maße, wie sie nicht auskunftspflichtig sind über ihre Gründe. Gelegenheiten zu stolpern sind freilich viele. Nicht nur der Wunsch, es genauer wissen zu wollen, bringt den kundigen Charmeur in ungeahnte Verlegenheiten. Auch seine weltläufige Vorliebe fürs Wohlig-Unscharfe. Kürzlich verwechselte er Mutter und Tochter. Beide kamen frisch von der Botoxkur. Hätte er nur besser hingesehen. Doch da hatte er schon mit dem Süßholzraspeln begonnen und sich gewählt über die überaus jugendliche Anmutung ausgelassen. Gefolgt von dem alles zerstörenden Satz an die Tochter: „Und Sie sind bestimmt die reizende Mutter.“
Sündhaft gesund
Jahrhunderte der Entmythisierung haben nichts gefruchtet: Die Sünde ist in die Heilkunst zurückgekehrt. Zwar taugt sie nicht mehr wie einst als metaphysische Erklärung für eine Krankheit, aber fürs Bauchzwicken, die Luftnot oder auch schwerere Malaisen sucht der Mensch nach Ursachen im eigenen Verhalten. Patient und Arzt verstehen sich am besten, wenn die Medizin als Teil der Moral erscheint.

Berliner Seiten
Fifa. Uefa. DFB
»Alles, was ich über Moral und Verpflichtungen weiß, verdanke ich dem Fußball.« So hat es der philosophierende Schriftsteller Albert Camus, einst Torwart und immer leidenschaftlicher Fan, im Jahr 1953 in der Zeitung seines algerischen Heimatverbands geschrieben. Wir hingegen können nur noch notieren: Alles, was wir über Unmoral und Pflichtverstöße wissen, trauen wir dem Fußball zu.
Loyal im Job
Was er denn sei, fragt die Dame aus der Begleitagentur den Journalisten. „Fester Freier“, antwortet er wahrheitsgemäß. „Ach, arbeitet ihr auch mit festen Freiern?“
Zu spät. Zu früh
Am Ende dasselbe: Die Zeit rennt ihm davon. Er ist seiner Zeit voraus.
Old Nick
Wer in England den Teufel nicht beim Namen nennen will aus Furcht, sich mit Bösem zu kontaminieren, greift zuweilen zum Pseudonym „Old Nick“. Da hat man dem verruchten politischen Vordenker Niccolò Machiavelli allerdings zuviel der Ehre angedeihen lassen. Auch wenn es an Arglist in manchem Kapitel seiner bekanntesten Schrift „Der Fürst“ nicht mangelt, hat der Florentiner Autor uns nie im Unklaren gelassen, welche Absichten er verfolgt, noch über die gelegentlich fragwürdigen Methoden der von ihm skizzierten Stadtoberhäupter geschwiegen. Als gemeiner Repräsentant des obersten aller Schurken ist er gewiss der ehrlichste.
Charmant von A bis Z
Charme ist kein deutsches Merkmal, wie uns nicht nur die stets unzureichenden Übersetzungen zwischen Anmut und Zauber vorwarnend verraten. Wo einer dennoch meint, sich in den fremden Formen des Liebreizes zu versuchen, kommt meist nicht mehr heraus als eine klägliche Verrenkung zwischen Anbiederung und Zudringlichkeit.
Freier Geist
Unter den Hochfesten im Kalender ist Pfingsten gewiss das entspannteste: kein Geschenkezwang, keine Verwandtschaftspflichten.
Pfingsten II
Zu denken geben sollte, dass in den wichtigsten traditionellen Texten über die Fähigkeit des Menschen, andere durch Worte zu erreichen, höhere Mächte mitspielen. Sokrates preist den Gott Eros als schöpferische Kraft in der Rede (Platon, Symposion 209a ff.). Im Testament wiederum wird von den Aposteln berichtet, die geisterfüllt so sprechen, dass sie selbst von den Fremden verständlich gehört werden können (Apg. 2, 1-18). Beide sind Wundergeschichten. Beide erzählen implizit vom Erstaunen, dass – nicht das Verstehen, sondern – das Missverstehen zwischen Menschen der Normalfall ist.
Pfingsten I
Es ist die Kunst eines Redners, aus den Anwesenden Zuhörer zu machen. Geistvoll indes ist sein Wort erst, wenn aus den Zuhörern Anwesende werden.
Wie nun?
Bei der Gruppenanrede hat sich im Maße wachsender Vertrautheit eingebürgert, statt des üblichen gemeinschaftlichen „Sie“ in das vermeintlich gelöstere „Ihr“ zu verfallen. Das erlaubt den Gestus der Leutseligkeit, ohne im Einzelfall gleich auf die gebotene Distanz verzichten zu müssen. Seit einiger Zeit erhält man allerdings auch in der direkten, individuellen Anrede immer mehr Angebote des lockeren Umgangstons. Und sammelt so ungeklärte Verhältnisse. Statt des strengeren „Frau“ oder „Herr“ heißt es nun, meist schriftlich, in schönster Holprigkeit gleich „Lieber …“, gefolgt von Vor- und Nachnamen wie auf dem Türschild. Man kann sich aussuchen, es als schlampige Form des „Sie“ zu lesen oder als verlegene Vorwegnahme einer künftigen Beziehung per du. Auf Dauer fehlte beiden Weisen der angemessene Ernst.
Vorfreude
http://www.youtube.com/watch?v=TLbA_g1HDMg
Christoph Niemann, Worldcup
Wo waren Sie zwischen 20 und 23 Uhr?
Krimi: die Logik als Literatur.
Professionelle Paradoxie
Nicht selten sind Menschen beruflich dann besonders erfolgreich, wenn sie beruflich nicht mehr erfolgreich sein müssen.
Die Brutalität des Niedlichen
Am 7. Januar 1858 schreibt Friedrich Engels an seinen Bruder im Geiste Karl Marx, dass er tief beeindruckt sei nach der Lektüre der Abhandlung „Vom Kriege“, mit der Carl von Clausewitz der Welt sein literarisches Vermächtnis gegeben hat. Besonders angetan habe ihm der Vergleich zwischen Krieg und Handel. „Das Gefecht ist im Kriege, was die bare Zahlung im Handel ist“, resümiert Engels, „so selten sie in der Wirklichkeit vorzukommen braucht, so zielt doch alles darauf hin, und am Ende muss sie doch erfolgen und entscheidet.“ Auch wenn der Autor statt über den Handel zu handeln die Händel herangezogen hätte, wird durch eine solche Analogie doch nur deutlich, woran der Marxismus historisch am Ende gescheitert ist: Die Theorie verniedlicht die Praxis.