Da hat einer zur Unzeit ein paar Worte verloren. Nun weiß er nicht, die richtigen Worte zu finden.

Bahnhof Berlin-Spandau: Vorsicht bei der Zugeinfahrt
Da hat einer zur Unzeit ein paar Worte verloren. Nun weiß er nicht, die richtigen Worte zu finden.

Bahnhof Berlin-Spandau: Vorsicht bei der Zugeinfahrt
Sie ist ganz überrascht, sich in ihrem Alter noch verliebt zu haben. Das hätte sie nicht erzählen müssen. Ihr Gesicht strahlt in altersloser Anmut. „Frisch verliebt“ redet von mehr als dem Moment eines neuen Gefühls. Es beschreibt eine der Haupteigenschaften andauernder Zuneigung: Sie macht und hält jung.
Am Anspruch, Vorbild sein zu wollen, kann man nur scheitern. Wer weiß schon, wieviele einem nacheifern, und worin. An denen ist es zu bestimmen, was sie in ihrem Idol sehen. Einem Menschen von Charakter wird eine solche Zuschreibung mustergültiger Eigenschaften eher verlegen machen als anspornen. Denn in ihr ist die Forderung der Formbarkeit versteckt, nur ja keine eigenen Prinzipien zu entwickeln. Der Vorwurf, einer Vorbildfunktion nicht zu entsprechen, richtet sich gegen jene, die ihn erheben. Das Beispielhafte taugt nicht als Maßstab.*
*Mit David Riesman ließe sich der selbstgewählte Wunsch, ein Vorbild darzustellen, als Bedürfnis des außengeleiteten Typus beschreiben, der ausgezeichnet ist durch „die außergewöhnliche Empfangs- und Folgebereitschaft, die er für die Handlungen und Wünsche der anderen aufbringt“ und der ein Phänomen der Massenmedien ist. (Die einsame Masse, 38) – Wollen wir wirklich die Fußball-Nationalspieler als Vorbilder zur Weltmeisterschaft reisen lassen oder nicht lieber als starke Individualisten, die auf nichts Rücksicht nehmen als ihren Willen zu gewinnen?
Das Menschliche an der Maschine: Die phantasiereichsten Irrtümer unterlaufen dem Computer beim Bemühen, Schreibfehler selbst zu berichtigen.
„Die Landschaft als solche existiert nur im Auge des Betrachters.“* Vor allem mitten in der Stadt ist die Natur ein Kunstwerk.

Museum der bildenden Künste, Leipzig
*August Wilhelm Schlegel, Vorlesungen über schöne Literatur und Kunst, Erster Teil: Die Kunstlehre, Heilbronn 1884, 203
„Sind Sie auch Venerologin?“ fragt der Mann die behandelnde Hautärztin. „Ja“, antwortet sie, das sei in ihrem Fach so üblich. Wo er denn Probleme habe? Als er ihr die auffällige Stelle zeigt, kann sie sich vor Vergnügen kaum beherrschen. „Darf ich Sie kurz aufklären“, unterweist sie ihn. „Venerologie kommt von Venus und bedeutet: die Lehre von den Geschlechtskrankheiten. Bei Ihrer geschwollenen Ader könnte ich freilich helfen. Ich bin auch Phlebologin.“
„Ah, das Kompromisswasser“, sagt die Kellnerin. „Das nehmen die meisten, wenn sie sich nicht gleich einig sind.“ Sie hat gerade gefragt, ob das verlangte Getränk still, stark sprudelnd oder eben medium gewünscht sei. „Dazu hätte ich gern das Kompromisssteak“, ergänzt der Gast mit flinker Zunge. „Und wie soll es sein: blutig, durch oder … ?“ Erst jetzt bemerkt sie die kleine Falle, die ihr gestellt wird und in die sie prompt hineingetappt ist. Manchmal hat der Kompromiss eine Dimension eigenen Rechts. Und nicht nur in der Küche gilt, dass das Mittelmaß zu treffen, alles andere ist als mittelmäßig.
Im Konzerthaus zwischen zwei Sätzen. Sobald der letzte Ton – nicht verklungen, aber – zu Ende gespielt ist, setzt im Publikum zuverlässig nervöses Husten ein. Es ist so lästig wie unvermeidlich. Zwanghaft scheint es dem Zuhörer in der Kehle zu kitzeln, unabhängig vom Erkältungszustand oder allergischen Reiz. Worauf reagiert der Körper? Nimmt man das Geräuspere und Gekrächze zum Gradmesser, dann scheint die Anspannung während des musikalischen Vortrags besonders hoch zu sein: Nichts tun zu können, ja zu dürfen, außer über sich ergehen zu lassen, dass da andere, und sei es noch so schön, ihre Instrumente virtuos einsetzen, das überfordert offenbar jene, die nicht verstehen, dass auch der Zuhörer am Gelingen des Stücks teilnimmt. Er verlängert das Orchester in den Konzertsaal. Sein Beitrag an der Symphonie ist die konzentrierte Stille. In einem sensiblen Gespräch hat Daniel Barenboim jenen Moment beschrieben, in dem der letzte Ton noch um eine Sekunde des Verweilens bittet: „Diese Klang-Stille-Beziehung ist permanent in der Musik. Man braucht diese letzten Sekunden, um genau das zu erleben, besonders nach einem Stück, das sehr leise endet. Es ist so, wie etwas auf den Tisch zurücklegen, ganz langsam und sanft, ein Buch, nachdem man gelesen hat, die Tasse, nachdem man Kaffee getrunken hat. Es ist nichts philosophischer als das. Aber ich glaube, diese Sekunden sind sehr, sehr wichtig.“ (SZ vom 12./13. April 2014)
Der rüstige Rentner mit seinem eleganten Rad lässt sich nicht abschütteln, auch nicht durch höhere Trittfrequenz. Seit etlichen Kilometern fährt er beschwingt in meinem Windschatten. Zwei, drei irritierte Blicke nach hinten beeindrucken ihn nicht. Im Gegenteil, als die Anhöhe mich aus dem Sattel zwingt, zieht er elektromobil vorbei. Sigmund Freud sprach einst von den drei großen narzisstischen Kränkungen der Menschheit: der kosmologischen Entdeckung, dass die Welt nicht der Mittelpunkt des Alls ist, der biologischen, dass der Mensch von den Tieren abstammt, und der psychologischen, dass das Ich nicht allein durch das Bewusstsein gesteuert wird. Es waren schmerzhafte Einsichten der Wissenschaft für das überkommene Selbstverständnis. Die nächsten Kränkungen indes sind alle technischer Natur und zielen auf die Überwindung des Menschen durch den Menschen.
Oft wird beim Versuch der eleganten Unterredung, die als Small Talk eine fürs allzu deutsche Gemüt kaum beherrschbare, beiläufige Selbstdistanz erfordert, nur auf den Eingang geachtet: die Neigung zum tiefen Sinn zu verstecken in der Oberfläche einer scheinbar belanglosen Bemerkung. Dabei ist der Ausgang mindestens so entscheidend bei dieser heiteren Kunst: Sie mag als gelungen gelten, wenn auch dem letzten leichtfüßigen Satz ein unsichtbarer Widerhaken beigefügt ist, in dem sich die flüchtenden Gedanken der Gesprächsteilnehmer verfangen.
Es ist überraschend angenehm, Menschen, meist älteren, zu begegnen, die sich noch auf die Tugend der Diskretion auch sich selbst gegenüber verstehen. Nichts ist verlässlicher als ein Mann, der seine Neugier ein Leben lang gezügelt hat, über sich Genaueres wissen zu wollen. In kluger Zurückhaltung nimmt er Abstand von der wiederkehrenden Versuchung, die eigenen Abgründe auszuloten. Er ahnt wohl, dass beim Versuch, diese seelenkundlich zu vermessen, nur Launen, Empfindlichkeiten, Unversöhntes hervorgeholt werden. Da bleibt er lieber an der Oberfläche und wirkt so erstaunlich tief.
Es ist ein Glück, das Glück nicht gleich im Superlativ suchen zu müssen.
Dasselbe noch einmal, aber ganz anders? Die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod verrät zum Glück wohl mehr über die Reichweite unserer Phantasie, als dass sie Auskunft gibt über das, was uns einmal erwartet. Des Spießers Himmelreich kommt anderen vor wie der muffigste Höllenpfuhl.

Bestatters Bücherkiste: Dieses Institut im Hamburger Stadtviertel Pöseldorf sieht den Tod offenkundig als friedlichen Übergang in ein ewiges Lesevergnügen. Doch hat der Bibliophile bessere Chancen, bei der großen Abrechnung im Buch des Lebens zu stehen? Da wird wenig helfen, was uns hienieden von Zeit zu Zeit einen Vorteil verschafft: Belesenheit
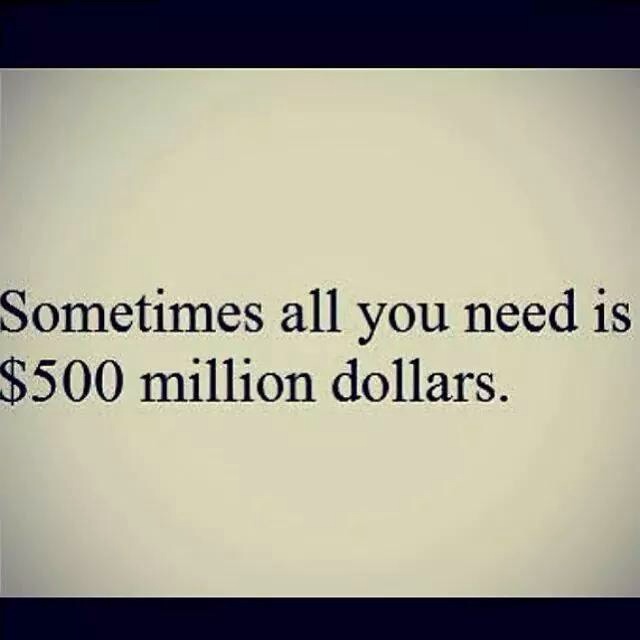
Anlässlich eines Films: Wie schön, dass in anderen Sprachen Anmut und Gnade dasselbe Wort sind. Der Zauber, der sich nicht erklären lässt, kann nicht erworben, er muss verdankt sein.
Wie früher die Friedhöfe außerhalb der Stadt lagen, damit die Toten durch die Lebenden nicht gestört werden (oder war es umgekehrt?), so entsorgen wir unseren täglichen Wortmüll, damit wir uns um das Geschwätz von gestern nicht mehr kümmern müssen. – Die Paradoxie des Verdrängens macht das Urteil zu Google von dieser Woche deutlich, das ein Unternehmen daran erinnert zu vergessen.

Papierfabrik in Fulda, vom ICE aus gesehen
Das gute Gewissen ist eine Erfindung jener, die nicht mehr wissen können, dass ein Gewissen als moralische Instanz nur fühlbar ist, wenn etwas schiefzulaufen droht oder gar daneben gegangen ist. Auffällig wird diese besonders empfindsame Art des Bewusstseins stets nur als schlechtes. Wer ein reines Gewissen hat, ist zwar nicht gewissenlos, aber kann sich gewiss sein, dass er von dessen Einreden frei bleibt. Er spürt es nicht. Als vielleicht letzter Zeuge dieser über Jahrhunderte selbstverständlichen Unterscheidung mag ein Werbeclip gelten, der Anfang der siebziger Jahre abends den deutschen Haushalten die Vorteile eines Weichspülers empfahl. Zu Anfang des Films spricht die sonor mahnende Stimme aus dem Off: „Jetzt meldet sich ihr Gewissen.“ Die Hausfrau hatte versäumt, in den Spülgang einen Becher des Wundermittels zu kippen. Der Begriff „Gewissen“ stand selbstverständlich für das schlechte, augenfällig in der schattenhaften Verdoppelung der Figur, die fürsorglich Fehler aufzeigt. Dabei allerdings konnte es nicht bleiben in einer Zeit, die sich mit großem Tamtam von überkommenen Wertmaßstäben studentenbewegt zu lösen begonnen hatte und mit diesem Ruf nach Tabufreiheit moralischen Autoritäten aller Art den Garaus zu machen bereit war. Im betulichen Gestus der Fernsehreklame von damals wird nun also das gute Gewissen eingeführt, das am Ende belohnt mit der schönsten aller Versicherungen: „Alle haben dich so lieb.“ Die Welt ist in Ordnung, so lang es sich in ihr auf weichgespülter Wäsche kuscheln lässt. An die Stelle des schlechten Gewissens
ist die schärfste aller Drohungen getreten, die eine durchanalysierte Gesellschaft kennt: der Anerkennungsverlust. Mit Ächtung wird bedacht, wer sich den Erwartungen der anderen zuwider aufführt. Das schlechte Gewissen ist aus dem Inneren ausgewandert in die soziale Welt (woher es dem Modell der Psychoanalyse zufolge ohnehin stammt) und kehrt wieder als negative Folie jener stets wirkenden Erleichterung, den Liebesentzug gerade noch vermieden zu haben. Das gute Gewissen ist keine Qualität der Moral mehr. Es funktioniert über die Gewähr von Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Kreisen, die es in Form eines modernen Ablasshandels lebendig halten: Geld gegen das Gefühl, die Welt wieder ein Stück kuscheliger gestaltet zu haben. Der Ablassbrief von heute ist die Spendenquittung nach dem Besuch einer Charity-Veranstaltung. Danach muss man sich über die eigenen Wertvorstellungen keine Sorgen oder gar Gedanken mehr machen.
Sobald die Regale vollgestopft sind, sortieren sich die Bücher wie von Zauberhand geleitet stapelweise nach einer natürlichen Ordnung auf dem Boden. Keine Frage mehr, ob man sie nach alphabetischer oder chronologischer oder thematischer Reihung verteilen soll. Das Schema ist auf verblüffende Weise schlicht und teilt ein in solche, die man noch nicht gelesen hat, in andere, die man nicht lesen wird, und jene, die man nie lesen wollte, aber vielleicht lesen muss. Die Arbeit übernimmt das Lustprinzip.
Vielleicht ist der Einfluss auf einen anderen Menschen nicht mächtig; aber er ist meist ermächtigt. Die Macht rechnet mit Widerspruch, der Einfluss mit Zustimmung.
Unbeirrt kann handeln, wem die Trennung von Empfindlichkeit und Empfindsamkeit gelungen ist. Nichts muss ihn treffen, auch wenn er fähig bleibt, es jederzeit mit feinem Gespür wahrzunehmen. Das macht es Gegnern seiner Pläne schwer. Gewöhnlich erreicht er sein Ziel, weil er sich kaum noch beeindrucken lässt. Es ist eine der ersten Aufgaben des strategischen Handelns, bei sich zu prüfen, womit ein anderer erfolgreich drohen könnte. Im Maße, wie selbst Letztes nicht mehr schreckt, den Drohenden mehr kostet als den Bedrohten, sind Ziele erreichbar. Sekten, Ideologien, religiöser Wahn machen sich die Differenz zwischen Empfindlichkeit und Empfindsamkeit zunutze, um ihre meist üblen Absichten ungestört zu verfolgen. Die Abgestumpftheit hier erreichen sie mit nervösester Erregung dort. Terror kann nur ausüben, wer den Tod nicht fürchtet, ja herbeisehnt. Der brutale Gewalttäter lässt sich von seiner Lust an ungehemmter Körperverletzung selbst nicht abbringen, wenn er dabei durch Videokameras beobachtet wird und zuverlässig damit rechnen muss, für lange Zeit eingesperrt zu werden. Dem skrupellosen Söldner macht es nichts aus, überrumpelt zu werden, wenn er sich zuvor nur daran laben konnte, wie er der Weltgemeinschaft deren Ohnmacht vor Augen führt. Und eine „Sicherheits-Junta“ (Peter Weibel auf der re:publika 2014 über die NSA) schaltet Überraschungen dieser Art systematisch aus, indem sie durch flächendeckende Überwachung ohnehin weiß, was gedroht wird und wie groß die Bereitschaft der Drohenden ist, sich beim Wort nehmen zu lassen. Da kann sie sich in eigener Sache sogar wieder äußerste Empfindlichkeit leisten, hat sie doch die „Empfindsamkeit“ an die technische Empfindlichkeit von Apparaten delegiert. Die Welt hat kein anderes Mittel gegen Gleichgültigkeit, als darum unausgesetzt zu kämpfen, dass solche Unterschiede wie die zwischen Empfindlichkeit und Empfindsamkeit erkannt, gewahrt und geachtet werden.
Der Freund, stets auf heiteren Ausgleich bedacht, unterbricht das Gespräch zur Lage der Dinge und fragt tadelnd, warum die Einschätzung so düster ausfalle. Das unterscheidet die Welt vom Menschen, dass sie sich durch ein freundliches Lächeln nicht anstecken lässt. Sie verzieht keine Miene, aber erscheint umso finsterer, je mehr man sich um gute Laune bemüht.
So viele Gegenstände, über die zu reden oder zu denken lohnte, gibt es nicht, wie eine nimmermüde Veranstaltungsindustrie zu formulieren verlangt. Der Einfall eilt dem Erkenntnisinteresse voraus. Hauptsache, eine griffige Überschrift ist gefunden. Was deren Erfinder sich dabei gedacht haben könnte, will man schon gar nicht mehr wissen, wenn sich nur genügend Namhafte zum gefälligen Vortrag einfinden, die ihren Sprachschwall assoziativ über das Publikum ergießen. Bedeutung hat, worauf sich dieses mit der plaudernden Prominenz durch pünktlichen Beifall geeinigt hat. In Geistesdingen erschlägt die Kommunikation die Produktion.
Zum Abschluss der Jubiläumssaison in der Fußball-Bundesliga ein Kommentar von Kurt Tucholsky über „die klassische Scheußlichkeit der Sportpreise“ (zuerst erschienen unter dem Pseudonym Peter Panter in der Vossischen Zeitung vom 18. Januar 1931, Nr. 30). – Pep Guardiola, dem Meistertrainer des FC Bayern, ist „das Ding“ gleich beim ersten Titelgewinn mit der Mannschaft ob dessen unhandlicher Form und elementaren Schwere aus der Hand gefallen:
„Wenn einer, und er kann so schön Tennis spielen, dass die Bälle wie die Flintenkugeln über das Netz schmettern, so schön, dass sich die Raketts biegen und durch die Reihen der Zuschauerinnen ein ,Ah –‘ der Bewunderung läuft … dann bekommt er einen Preis. Das freut ihn. Uns anderen erscheint solch ein Sportpreis manchmal im Traum –, besonders nach schwereren Eierpuddings, zu denen ein stilloser Wirt uns Rotwein kredenzt hat. Dann tauchen Weiterlesen
Unter den Heilswörtern, mit denen wir die eigene Lösungskompetenz unter Beweis stellen, hat sich die „Transparenz“ in den vergangenen Jahren eine Sonderstellung erworben. Was ist nicht alles auf dem Wege der Besserung, sobald es nur vollkommene Offenheit im Umgang mit denen pflegt, die sich hintergangen fühlen: Geheimdienste sollen so politisch akzeptabel werden, die Parteien bürgernäher, die Banken ehrlicher, die Energieindustrie preissensibler, die Lebensmittel gesünder, Beziehungen fester. Die Regel lautet: Je größer Transparenz, desto stärker das Vertrauen. Verwundert erinnert sich der halbwegs kundige Leser abendländischer Gründungsmythen an jene Geschichte, in der die Schlange dem Menschen totale Transparenz versprach: Die Verlockung des Verführers, es könne das Geschöpf die Welt so durchschauen wie Gott, wenn es nur von der verbotenen Frucht des Gartens äße – wird sie nicht als der Anfang des Schlamassels dargestellt und nicht als das Ende des Misstrauens? In dieser Erzählung mag sich die schon früh gewonnene Grundeinsicht verdichtet haben, dass noch kein einziger Zuwachs an Information zerstörtes Vertrauen im ganzen wieder hergestellt hat. Gewachsen ist dadurch nur die Zahl der Missverständnisse.