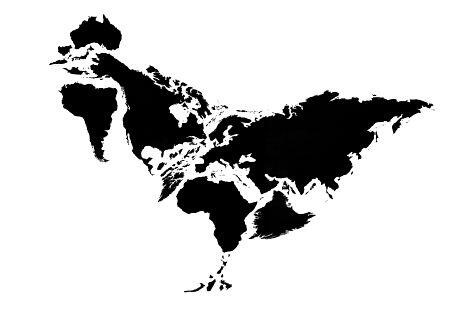Weihnachtskrippe von Manufactum
Mythen sind Geschichten, die mehr sein wollen als nur eine Geschichte. Als erzähltes System erklären sie die Welt. Sie schaffen Ordnungen und Zuordnungen, liefern Vorstellungen, wo die Angst vor Naturgewalten sich der Phantasie wild bemächtigt hatte, beruhigen Erwartungen, regeln Einstellungen, ermöglichen Anschlussberichte. In all dem setzen sie sich zwischen Mensch und Wirklichkeit, stellen sich gegen deren scheinbar willkürliche Eingriffe ins Leben, indem sie Einblicke zulassen in Entscheidungsmechanismen und Motivstrukturen. Das ist ihre Funktion, bis heute. Der Mythos erledigt sich nie. Sein Widerpart ist nicht das aufklärende Wissen, sondern die verabsolutierte Welt. In ihr sehen wir immer Anlass, weiterzumachen mit den erfundenen Sinngebungen des Ganzen, und seien diese noch so verkleidet als Theorien oder Utopien, Eschatologien oder Geschichtsphilosophien. Wir brauchen das Zwischenstadium des Erzählten, um sie auszuhalten. Nichts ist aktueller als der Mythos von gestern. Und jeder Versuch, ihn zu ersetzen durch Begriffe, scheitert schon daran, dass diese nicht enthalten, was in den Geschichten bilderreich berichtet wird. So auch jene eine, die an Weihnachten, wieder und wieder gelesen, die größte Entlastung vorstellt, die denkbar ist: In der Geburt des Weltenerlösers ist für den Menschen alles getan, ohne dass er etwas hinzufügen müsste. Nichts tun zu können, nennt man Glauben. Es ist die angemessenste Form von Leistungsverweigerung angesichts einer liebevollen Zuwendung, der zu entsprechen bedeutet, sich erfreut zu wundern. Die Geschichte geht so (Lukas 2, 1-20, in der Übersetzung von Martin Luther):
Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, daß alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Landpfleger von Syrien war. Und jedermann ging, daß er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum daß er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf daß er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die ward schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des HERRN Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des HERRN leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der HERR, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Laßt uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der HERR kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.