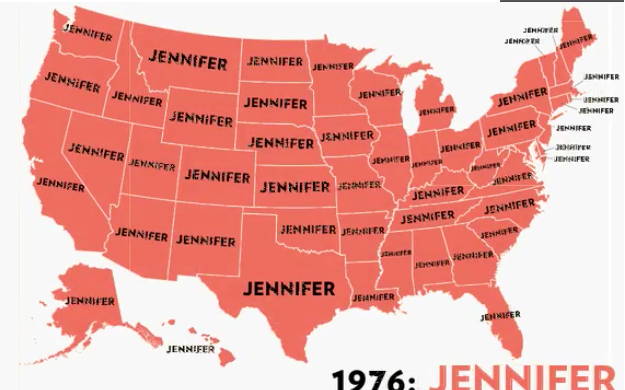Böses, das sich nicht versteckt, ist immer Gewalt. Es zielt auf Vernichtung und kann nur durch solche aufgehalten werden. Ob man diese Reaktion als dessen heimlichen Sieg anklagt, spielt keine Rolle mehr. So wie sich das Böse als absolute Herrschaftsform gibt, deren menschenverachtende Rücksichtslosigkeit alle Unterschiede einebnet, weil es nur die eine Differenz des Für oder Wider kennt, so muss auch die Moral lernen, dass die Reflexion und das Reden dort aufhören, wo das Rohe unmittelbar regiert. Zur Differenzierung wie der zwischen gut gemacht, gut genannt und gut gemeint bleibt keine Zeit, wenn die Sache so ernst wie evident ist und entschlossenes Handeln verlangt.
Kategorie: Allgemein
Ich hasse Notizbücher
Zu Zeiten, da Politiker ihrer vielen Talente wegen noch nicht gescholten wurden, sondern geschätzt waren, und sie auf verschiedenen Gebieten, auch finanziell, reüssierten, schrieb der 1922 ermordete Walther Rathenau Aufsätze, die von tiefen Einblicken ins Geschäftliche kündeten. Er war maßgeblich beteiligt an der Konzernentwicklung der AEG, die sein Vater gegründet hatte, rief mit Gesinnungsgenossen die Deutsche Demokratische Partei ins Leben und publizierte kultur- und gesellschaftskritische Bücher. In einem zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts erschienenen Essay zur „Physiologie der Geschäfte“ versammelte er jene Erfahrungen, die er als unerlässlich ansah für wirtschaftlichen Erfolg. „Gefährlich ist allgemeine Bildung; ich kenne nur wenige, die über den Schatz ihrer Kenntnisse nicht gestrauchelt sind“, hielt er dezidiert fest. Ohne allerdings einen antiintellektuellen Affekt zu zeigen. Im Gegenteil zeugen seine Schriften von einem durchweg neugierigen und weit interessierten theoretischen Geist, der nie den pragmatischen Gesichtspunkt einer Sache aus den Augen verlor. „Ich pfeife auf das, was man die großen Ideen nennt. Sie liegen auf der Straße. Sie kommen zu Dutzenden, dieses Gesindel, wenn wir träumen, wenn wir verdauen oder wenn wir Erholung suchen.“ Auch hier nichts wider den klugen Einfall, aber alles gegen die überladene Geste, die manchmal mit ihm einher geht und das Wesentliche verstellt. Der Kaufmann muss vor allem wach sein, schnell handeln können, den Überblick behalten, ein ausgewählt funktionierendes Gedächtnis besitzen, über Fleiß verfügen, sich zu begrenzen wissen – um jederzeit die günstigen Gelegenheiten ergreifen zu können. Bewunderung empfand Rathenau daher für Napoleon, von dem erzählt wurde, dass er über ein opulentes Erinnerungsvermögen gebot, das ihm erlaubte, sich an jedes noch so entfernte Detail zu entsinnen und dennoch das große Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren. Nicht ohne Selbstironie heißt es daher zusammenfassend: „Ich hasse Notizbücher. Wer viel notiert, ist ein Subalterner oder ein Dummkopf.“* Alles kommt darauf, seine Gedanken zu beherrschen, sie nach Belieben ins Bewusstsein rufen zu können oder sie zu vergessen, um Platz zu schaffen für Nachfolgendes. Nichts hingegen liegt an dem, was im Geschäftlichen entscheidend sein kann: am Besitz.
* Walther Rathenau, Physiologie der Geschäfte, in: Die Zukunft (hg. Maximilian Harden) vom 29. Juni 1901, 501ff.
Lustwandlung
Der Flaneur von heute schlendert nicht mehr durch die Straßen und Passagen einer Stadt, sondern streift planlos durch das digitale Netz.
Denunziationsdank
Das frische, knusprige Landbrot liegt schon eingewickelt auf der Theke. Er nestelt in der Hosentasche, um seinen Geldbeutel zu zücken; da fällt sein Blick durch eine Öffnung in die Backstube. Der Bäcker, sich unbemerkt wähnend, lutscht lustvoll den Kuchenteig von den Fingern. Ein gutes Zeichen, eigentlich, die Ware scheint zu schmecken. Doch der Ekel des unfreiwilligen Beobachters überwiegt. Als er die Münzen gedankenverloren auf den Tisch legt und die Verkäuferin ihm bedeutet, er möge für das Geld doch bitte künftig den eigens dafür bereitgestellten Teller nutzen, der Hygiene wegen, kann er sich nicht mehr zurückhalten: Der Kuchen scheine ja ausgesprochen lecker zu sein, wenn der Bäcker sich nicht einmal der kleinen, zeitaufwendigeren Mühe unterziehe, den Teigschaber zu nutzen, um zu probieren. Kurz sind sie beide irritiert ob der Denunziation. Schneller als er hat sich die Verkäuferin wieder gefasst und packt lächelnd noch ein Stück Schokoladenkuchen in die Tüte, als Dank für den Hinweis. Ob er sich freuen soll? Oder in seinem Widerwillen verharren? Und worüber: über den wohl auch abgeschleckten Schokoteig oder seinen Verrat?
Der rote Faden der Kultur
„Vielleicht mag es auf den ersten Blick als eine unnötige Komplizierung erscheinen, wenn bei jedem geschichtlichen Gebilde nach seiner Genese gefragt wird. Aber da nun jede geschichtliche Erscheinung, menschliche Haltungen ebenso, wie gesellschaftliche Institutionen tatsächlich einmal ,geworden‘ sind, wie könnten sich Denkformen als einfach und als zureichend zu deren Aufschluss erweisen, die alle diese Erscheinungen durch eine Art von künstlicher Abstraktion aus ihrem natürlichen, geschichtlichen Fluss herauslösen, die ihnen ihren Bewegungs- und Prozesscharakter nehmen und sie wie statische Gebilde unabhängig von dem Wege zu fassen suchen, auf dem sie entstanden sind und sich verändern? … Was hier versucht wird …, geht darauf aus, die Ordnung der geschichtlichen Veränderungen, ihre Mechanik und ihre konkreten Mechanismen aufzudecken.“*
* Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation, Bd. 1, LXXVII
Zeitwörter
Schreiben bedeutet, irgendwann vor die Entscheidung gestellt zu werden, für die Mitwelt oder die Nachwelt zu leben. Je höher die Ansprüche, desto größer die Anstrengungen, von der eigenen Lebenszeit genügend zu reservieren, um dem einsamen Geschäft eines stillen Gesprächs mit den Gedanken nachzugehen. Die heimliche Sehnsucht des Journalisten, Schriftsteller sein zu können, schielt darauf, dass die Wirklichkeit eines Texts dessen Wirksamkeit über den Tag hinaus erreicht. Die uneingestandene Hoffnung des Schriftstellers wiederum ist, die Wirklichkeit des Tagesgeschehens nicht zu verlieren bei dem Versuch, die Wirksamkeit eines Texts so anzulegen, dass auch übermorgen über ihn noch gesprochen wird.
Reflexion
Nicht Nähe oder Distanz zu den Mitarbeitern entscheiden darüber, ob ein Manager sein Unternehmen glücklich lenkt. Sondern ob er in der Lage ist, seinem Talent zur Nähe, seiner Begabung, Menschen zu gewinnen, gegenüber distanziert zu sein und ob er seine Fähigkeit, immer wieder Abstand zur Sache zu gewinnen, nutzt, um sie tiefer zu durchdringen.
Wie originell
Der Zauber der Autorschaft endet, wo die Verlegenheit der anderen beginnt, eingestehen zu müssen, die wirklichen Quellen nicht gekannt zu haben. In den meisten Fällen spiegelt die entdeckte Echtheit nur die Ignoranz derer wider, die sie beurteilen. Nichts ist schlimmer als aus unberufenem Munde entzückt zu hören: „Wie originell!“ Es gibt kaum ein klareres Indiz, auch hier mit Abklatsch Vorlieb nehmen zu müssen.

Originalität entsteht noch nicht dadurch, dass sich einer etwas einfallen lässt, und wird unfreiwillig komisch, wenn er sich auf sie beruft, indem er einen anderen schrägen Vogel ungenannt zitiert. – Fassade im Nordend
Metaphernstrudel
Machtgefälle einer Verhandlung: Jetzt hat sie wieder Oberwasser und taucht ab.
Lebensparadox
Auch das ist ein fester Standpunkt: die immerwährende Flucht als Existenzform.
Maulkörbchengrößen
Neckisches beim Nachmittagsspaziergang durch die städtische Grünanlage: Was ist der Unterschied zwischen einem Hundehalter und einem Büstenhalter? Dieser schnappt auf, wenn man ihn einzieht; jener schnappt ein, wenn man ihn aufzieht.

Sommerliches Stillleben: Verkehrschaos im Park
Ich sehe was, das du nicht siehst
Denken: Ich sehe was, das nicht zu sehen ist.
Philosophieren: Ich sehe mehr, als du siehst.
Grübeln: Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Lieben: Ich sehe dich, wie du dich nicht siehst.
Lehren: Sieh doch.
Darstellen: Schaut her.
Schämen: Schaut nicht so.
Beschämen: Schau dich an.
Überwachen: Ich sehe dich, du siehst mich nicht.
Sterben: Mehr Licht.
Was übrig bleibt …,
… wenn das Imperium zurückschlägt.

Offenbach Hafen
Sieh mal einer an
Eine der ersten Erfahrungen in der Entwicklungsgeschichte des Menschen war, dass derjenige, der besser sieht, auch besser gesehen werden kann. Einsichten und Weitsicht sind riskant. Wer aufgerichtet durch die Welt läuft und sich so einen Horizont schafft, ist leichter beobachtbar und stärker gefährdet. Es war daher fürs Überleben notwendig, früher zu sehen, was auf einen zukommt, und rechtzeitig wahrzunehmen, wovon man selber in den Blick genommen wurde. Dieses Wechselspiel bestimmt bis heute unser Leben. Was in der ästhetischen Formel „Sehen und Gesehen-Werden“ zur gesellschaftlichen Statusregel erhoben ist, beschreibt unterschwellig die Bedingung, unter der sich Freiheit allein organisieren kann. Viel kommt darauf an zu sehen, von wem man gesehen wird, und stets mehr zu sehen als andere: Dann kann sich ein Möglichkeits- in einen Gestaltungsraum verwandeln.

Falsche Optik: Mit dieser Brille kann niemand anderen schöne Augen machen. Kunst – nein: Handwerk in Obermenzing
Flacher Bildschirm
Aus Gründen erzwungener Sparsamkeit und stets angezeigter Steigerung von Effizienz sind viele Organisationen dazu übergegangen, ihre Konferenzen, Verhandlungen oder Beratungen über Videotelefonie zu arrangieren. Warum teuer und zeitaufwendig reisen, wenn man sich dasselbe auch vis à vis durch das Koaxialkabel sagen kann? Gegen das kaum bestimmbare Unbehagen, es könne doch Entscheidendes auf der Strecke bleiben und die Bildübertragung eine direkte Begegnung nicht ersetzen, stellen die kostensensiblen Kommunikationsingenieure das Argument, die notwendigen Informationen erreichten den Empfänger doch präzise. Dass er zudem auch noch der Gesichtsmimik folgen könne, sei ein kaum schätzbarer Vorteil. Wie wenig hingegen wirklich bei anderen ankommt, kann man leicht testen: Man halte einmal einem Hund den Bildschirm hin, aus dem sein Besitzer spricht. Der mag ihn rufen, gestikulieren, ja bellen; das Tier wird sich nicht rühren. Offenbar fehlen wesentliche Merkmale zur Wiedererkennung. Die Instinkte können nicht reagieren. Unterstellt, dass Unterredungen in ihrem Erfolg abhängig sind von weit mehr als der geteilten Information, dass unterschwellige Wahrnehmungen, das Sprachensemble einer ganzen Atmosphäre, eine handfeste Rolle spielen, so erscheint es als ein diskretes Wunder, wenn oft genug über digitale Wege der Austausch dennoch vernünftig funktioniert. Der Austausch. Aber ein Gespräch? Das ist die Kommunikation als Kunstwerk angesehen und substantiell deutlich mehr als die Tauschware einer Mitteilung. Könnte ein Hund verstehen, er begriffe leicht, um nicht zu sagen: instinktiv, dass ein Gespräch auch dann noch existiert, wenn die Sprechenden nicht mehr miteinander reden. Es ist eine Dimension eigenen Rechts, der Raum, in dem der Wortwechsel überhaupt erst sinnvoll möglich ist. Gespräche sind nicht Ergebnisse des Bemühens, miteinander zu reden, sondern dessen Voraussetzung.
Raummaße
„Mein Kopf ist so leer“, sagt der Hohlkopf.
„Dann ist er wenigstens nicht mehr voller Dummheiten“, antwortet der Schlauberger.
Warum Veränderung nicht möglich ist
Zenons Paradoxien, als antikes Computerspiel
Lucky or happy?
Glück hat am Ende nur der Glückliche.
Bitte lächeln
Vielfach bewirkt das „nach-“ als Vorsilbe, dass ein Tun – zwar nicht aus seinem ureigenen Zusammenhang gerissen wird, aber – leicht deplatziert erscheint. Es ist verrückt wie ein kleines Möbel, das versehentlich einen Stoß bekommen hat und nun irritierend nicht mehr genau an Ort und Stelle steht. Post, die nachgesendet wird, erreicht den Empfänger, allerdings nicht zu Hause. Äußerungen, die einen Nachgeschmack haben, besaßen vielleicht schon während der Rede einen Beigeschmack. Das Problem ist: Man wird ihn nicht los. Nacherzählt sind Geschichten längst nicht mehr so interessant; nachgehakt Fragen immer noch nicht befriedigend beantwortet. Die Sache geht in die Verlängerung. Eine Dimension eigenen Rechts indes stellt das Nachlächeln dar. In ihm kommt allererst die ganze Anmut eines Gesichts zum Vorschein, das gerade aus einer Verabschiedung im Nachbarzimmer herausgetreten ist und den freundlichen Zug für einen langen Moment mitgenommen hat, ohne dass der Beobachter sehen kann, wem er gegolten hat. Dieses Lächeln ist ganz bei sich, gerade weil es so verloren erscheint, und verrät kurz vor seinem Verschwinden alles über die Echtheit seiner Motive.
Spontanheilung
Am Telefon klingt seine Stimme, als würde er alsbald aus dem Leben scheiden. Ihm gehe es überhaupt nicht gut, sagt er. Krank? Nein. Überarbeitet? Etwas. Die Beziehung? Er könne jetzt darüber nicht reden, heißt es lapidar. Die eigene Phantasie malt nach diesem knappen Gespräch nachtschwarze Szenen und schwankt zwischen jener Diskretion, die eine Einmischung verbietet, und dem jederzeit bereiten Gestus einer heilsamen Intervention. Zwei Tage später hält es die Sorge um das Wohlergehen des Freunds nicht mehr aus. Eine Kurznachricht: Und? Besser? Ja, kommt die Antwort prompt. Die Schwiegereltern sind abgereist.
Herzzerreißend
Ihr wurde das „r“ aus dem Gefühl gerissen: Erst war sie nur verwundert. Nun ist sie verwundet. Und spürt den Schmerz.
Wie heißt du?
Ganz im Gegenteil
Bei ein bisschen Geduld entpuppt sich der bockige Satz: „Ich habe nichts zu sagen“, in einem Streit gesprochen, zuverlässig als der letzte Moment versuchter Zurückhaltung, von dem an die Worte aus einem herausquillen wie der Saft aus einem angestochenen prallen Apfel.
Reflexionsarmut
Nachricht von heute: Die Deutschen wissen nicht, wie gut es ihnen wirklich geht. Und fühlen sich gern schlecht. – Das zeichnet ja die höchste Form des Wohlbefindens aus, dass man nicht weiß, wie gut es einem derzeit geht. Im Aufzählen von Malaisen sind wir jedenfalls viel genauer.